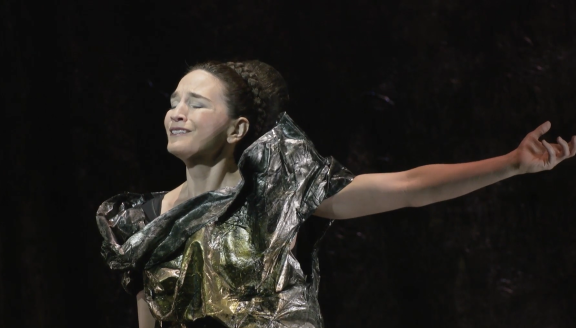Trennungen in der Oper
Am Ende der Liebe, jenseits der Liebe
Die Oper, die Kunstform, in der sich die Liebe zu den höchsten Höhen aufschwingt, verzeichnet auch ihre tiefsten Abstürze. Das Publikum mag sich zwar nach romantischen Duetten sehnen, doch die tiefsten Wahrheiten der Liebe offenbaren sich oft erst in der Trennung der Figuren. In den folgenden Ausschnitten werden wir uns mit den großen Abschieden in der Oper beschäftigen. Diese Lebewohls sind nicht einfach nur erzählerische Formeln, sondern Ausdruck von Liebe, die an ihre Grenzen stößt: wo Sehnsucht mit Einschränkung kollidiert, wo Illusionen zerbrechen und wo die Liebe sich dem Gewicht des Schicksals beugen muss …
Das grausame Gesicht der Trennung
In der Schlussszene von Carmen sehen wir das grausame Gesicht des Vergehens der Liebe – nicht nur in Carmens unerschütterlicher Entschlossenheit zur Freiheit, sondern auch darin, wie Don Josés Liebe tödlich wird. Carmens Liebe brennt rein und ungezähmt, während Don Josés Liebe, befreit von Leidenschaft und Zärtlichkeit, die knochenharte Klinge darunter offenbart. Madama Butterfly hingegen bietet eine Verwüstung mit leiserer Note. Pinkertons Abschied „Addio, fiorito asil“ ist voller Kummer, doch er klingt hohl. Sein Bedauern kommt zu spät und kostet ihn nichts. Für Butterfly war die Liebe absolut; für Pinkerton war sie nur eine vorübergehende exotische Fantasie unter dem Deckmantel der Romantik. Beide Frauen – die eine aus Trotz, die andere aus Verzweiflung – verteidigen die Reinheit ihrer Liebe auf die einzige Weise, die ihnen bleibt.
Liebe vs. Schicksal
In der Oper wird nicht nur das Vergehen der Liebe dargestellt; auf überragende Weise wird Liebe durch die Realität zerrissen. Nach anfänglichem Glück wird das Gedeihen der Liebe durch Krankheit, Armut, Krieg oder die starren Klassengrenzen unterdrückt, was die Figuren dazu zwingt, die Trennung wie ein langsames Ersticken zu ertragen. Zwei der ikonischsten Tragödien der Oper, La traviata und La bohème, lassen das Schicksal von Violetta und Mimì von Anfang an vorausahnen. Die Liebe blüht wie die Blume, die Violetta Alfredo überreicht, sie flackert wie eine Kerze, die Rodolfo anzündet – doch Blumen verwelken, Kerzen erlöschen, genauso wie Violettas und Mimìs Leben entgleiten. Im Vergleich dazu mag Manon glücklicher erscheinen. Sie verliert nie wirklich die Liebe, doch der Konflikt zwischen ihrer Sehnsucht nach Zuneigung und ihrem Hunger nach Status und Luxus lässt sie langsam zerbrechen. Diese zerrütteten Liebesbeziehungen zeigen, dass die Liebe, so tief sie auch sein mag, nicht alle menschlichen Dilemmata lösen und uns nicht vor den Folgen unserer Entscheidungen schützen kann. Auch in Guillaume Tell reißt die Kluft von Klasse und der Rache zwischen Arnold und Mathilde die beiden auseinander. Doch in einem seltenen Moment der Hoffnung entscheidet sich Mathilde am Ende der Oper, sich dem Kampf für die Freiheit an Arnolds Seite anzuschließen – ein Beweis dafür, dass manche Herzen noch den Mut und die Fähigkeit finden, dem Schicksal zu trotzen.
Am Scheideweg
Manche Abschiede in der Oper lassen uns nicht nur traurig, sondern auch ehrfürchtig zurück. Ein weiterer Klassiker unter den „einfach-zu-spät-Momenten“ findet sich in Eugen Onegin: Während Onegin schließlich gesteht, ist Tatjanas Weigerung so stark, wie ihre Liebe aufrichtig war. Angesichts der eindringlichen Verlockung des „Glücks, das zum Greifen nah war“ entscheidet sie sich für die Würde statt für die Begierde und hält ihre Werte noch, auf Kosten ihres Herzens. Leonora (Il trovatore), gefangen in einer tragischen Verkettung aus Rache und Täuschung, entscheidet sich ebenfalls für Loyalität – allerdings um den Preis ihres Lebens. Heimlich trinkt sie Gift und opfert sich in einem verzweifelten Versuch, ihren Geliebten zu retten. In Norma entscheidet sich die verratene Hohepriesterin ebenfalls dafür, sich zu opfern, um das zu schützen, was ihr noch heilig ist: ihren Glauben, ihre Kinder und die Liebe, die sie einst hatte. Diese Entscheidungen am Scheideweg werfen ein goldenes Licht auf das breite Spektrum der Liebe in der Oper.
Liebe und Tod
In Donizettis L‘elisir d‘amore glaubt Nemorino in seiner Naivität an die Geschichte von Tristan und Isolde und trinkt einen „Liebestrank“, der sich zwar als Wein entpuppt, ihn aber trotzdem das Herz von Adina gewinnen lässt. Doch in der Geschichte von Tristan und Isolde offenbart der Zaubertrank lediglich die Liebe, die die ganze Zeit über ohnehin verborgen war. So wie die mächtigen Zaubersprüche der Zauberin Alcina durch die Ankunft der wahren Liebe zunichte gemacht werden, zeigen beide Opern, dass die Liebe, obwohl sie auf geheimnisvollen Wegen kommt, nicht künstlich hergestellt werden kann. Sie lässt sich nicht kontrollieren – und sie geht Hand in Hand mit dem Tod. In von der Mythologie inspirierten Opern wie Dido und Aeneas und Orfeo ed Euridice sind Liebe und Tod nahezu untrennbar miteinander verbunden. Aufbruch und Rückkehr, Rückblick oder Verweigerung – alles führt zum selben Ende. In diesen ewigen Widersprüchen wird die Klage des Abschieds zum letzten Zeugnis der Liebe.
Wie alle schönen Dinge im Leben beginnt die Liebe mit der Erkenntnis, dass sie unweigerlich zu Ende geht. Abgesehen von der mitreißenden Musik und dem Seufzer von „Nichts währt ewig“ bieten uns Trennungen in der Oper auch philosophische Überlegungen zu Entscheidungen, zur Existenz und zur nicht reduzierbaren Komplexität des Menschen. Lauschen Sie diesen Momenten der Trennung, wenn uns Oper mit ihrem unbeirrten Blick den Mut gibt, Liebe und Verlust in einer Hand zu halten.
Siqi Luo
Übersetzt aus dem Englischen